Implizites - Explizites Wissen
Relevanz oder Quantität?
Journalisten oder Wissenschaftler müssen an der Hürde der Gatekeeper und ihrer Qualitätskontrolle vorbei, wollen sie ihre Werke veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, ob es solche Gatekeeper auch im Internet gibt. Clay Shirky (2005) sagt dazu: “The Web has an editor, it’s everybody”. Eine Qualitätskontrolle des Contents findet statt – jedoch erst nach seiner Veröffentlichung. Je mehr Nutzer ein Dokument taggen, desto mehr Relevanz scheint dieses Dokument für sie zu haben. Ist dies aber eine ernstzunehmende Qualitätskontrolle? Wird etwas zu „geprüfter“ Qualität, nur weil viele Leute dies so sehen? (Wenn viele Studenten bei einer Mathematikklausur die gleiche – falsche – Lösung bringen, wird diese nicht dadurch qualitativ wertvoll, sondern bleibt falsch. Quantität bedeutet nicht Qualität. Andererseits weist es in eine bestimmte Richtung, wenn viele Nutzer ein Stück Information mit stupid und ein anderes mit cool taggen. Dieser Content könnte für das Relevance Ranking verwertet werden.
// Peters, Isabella / Stock, Wolfgang G. 2008: Folksonomien in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. Information - Wissenschaft & Praxis. 59(2008)2. S. 81
Glocalisation
We find community in networks, not groups (...) In networked societies: boundaries are permeable, interactions are with diverse others, onnections switch between multiple networks, and hierarchies can be flatter and recursive (...) Communities are far-flung, loosely-bounded, sparsely-knit and fragmentary. Most people operate in multiple, thinly-connected, partial comunities as they deal with networks of kin, neighbours, friend, workmates and organizational ties. Rather than fitting into the same group as those around them, each person his/her own personal community. (...) Huge increase(s) in speed (have) made door-to-door comunications residual, and made most communications place-to-place or person-to-person. (...) The household is what is visited, telephoned or emailed.
// Wellman, Barry 2001: Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. In: International J. Urban and Regional research. Jg. 25. S 227-252. S. 233f
Ontologische Bodenlosigkeit
Das Leben in der Wissens-, Risiko-, Ungleichheits-, Zivil-, Einwanderungs-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft verdichtet sich zu einer verallgemeinerbaren Grunderfahrung der Subjekte in den fortgeschrittenen Industrieländern: In einer "ontologischen Bodenlosigkeit", einer radikalen Enttraditionalisierung, dem Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten. Subjekte erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige Drehbücher geliefert würden. Genau in dieser Grunderfahrung wird die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar. Es klingt natürlich für Subjekte verheißungsvoll, wenn ihnen vermittelt wird, dass sie ihre Drehbücher selbst schreiben dürften, ein Stück eigenes Leben entwerfen, inszenieren und realisieren könnten. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Chance auch realisiert werden können, sind allerdings bedeutend. Die erforderlichen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen sind oft nicht vorhanden und dann wird die gesellschaftliche Notwendigkeit und Norm der Selbstgestaltung zu einer schwer erträglichen Aufgabe, der man sich gerne entziehen möchte. Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu inszenieren, hat ohne Zugang zu der erforderlichen Ressourcen, etwas zynisches.
// Keupp, Heiner 2003: Identitätskonstruktion. Vortrag bei der 5. bundesweiten Fachtagung zur Erlebnispädagogik am 22.09.2003 in Magdeburg; Online im Internet: www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf (29.06.2010)
Why People Choose Work Group Members?
In our study, people are choosing group members for future projects based on people’s reputation for competence. People may not actually know each other’s grades or the number of hours put in on previous projects, but it is clear that a reputation for competence is developed and circulates within the organization. Further, it is an important basis on which people develop their preferences for future group members. It is interesting to note that grade point average was not a significant predictor of being chosen as a team member. This may indicate that people do not choose others based on general indicators of competence or that information on grade point average and general competence circulate less freely in these groups or are harder to assess.
Finally, we hypothesized that people would choose others with whom they were already familiar for future work groups. This hypothesis was partially supported. But, our analysis indicates that familiarity alone is not adequate to generate a future work tie. During the course of project 1, people established working relationships with others in their group. These relationships varied over time, but on average, each person had either a strong or weak tie with each other member in his or her current group. Where there were strong ties, people elected to continue those relationships in future work groups. This is consistent with Kilduff’s (1990) finding that MBA students, when they look for jobs, want to work in the same companies as their friends. These data suggest that familiarity may lead to an awareness of whether or not an ongoing working relationship is effective. If a relationship is successful, then people are especially inclined to repeat it. This is consistent with our argument that people are seeking to reduce uncertainty in their choice of future group members. Although there may be better group members in the organization, people are choosing a “sure thing” rather than taking the risk of working with someone who has a work style and work ethic with which they do not have personal experience.
// Hinds, Pamela J. / Carley, Kathleen M. / Krackhardt, David/ Wholey, Doug 2000: Choosing Work Group Members: Balancing Similarity, Competence, and Familiarity In: Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 81, No. 2, March, S.
![]()

Identität
Rollen innerhalb formeller und informeller sozialer Netzwerke bilden eine wichtige Grundlage für Barrieren bei der Externalisierung von Wissen. Um die Bedeutung von eingenommenen und zugeschriebenen Rollen genauer zu verstehen, müssen wir uns ebenfalls mit den Identitäten der Wissensakteure beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Konzepten und Theorien zur Identitätsbildung erleichtern das Verständnis für relevante Prozesse der Computervermittelten Kommunikation und für die Barrieren und Widerstände bei der Weitergabe von Wissen gerade in der Arbeit virtueller Gruppen und der Einbeziehung externer Mitarbeiter in organisationaler Hinsicht sowie im Umgang mit künstlerischem und technischem Personal in Kommunikationshinsicht.
Begriffsklärung
Eine kurze und knappe Definition von Identität kann kaum gelingen. Zu unterschiedlich ist der Begriff in seiner philosophischen, kultur-philosophischen, soziologischen, psychologischen und nicht zuletzt juristischen Dimension. Die Vorstellung vom Wesen des Ichs ist nachgerade so sehr Teil der menschlichen Entwicklung, dass wohl kein Verhalten ohne eine handelnde Entität denkbar ist, doch wie jede psychologisch-soziologische Annäherung neben diesem Ich der personalen Identität immer das Wir einer sozialen Identität verlangt, so ist für ein Verständnis sozialer Prozesse, und jeder Akt der Wissensweitergabe ist ein solcher sozialer Prozess, ein vertiefendes Begreifen der Akteure zwischen den Polen personaler Selbstdefinition und sozialer Bestimmung notwendig.
Als soziale Identität können zwei sich vielfältig gegenseitig beeinflussende Bewegungen verstanden werden. Zum einen die Identifikation mit einer sozialen Gruppe wie der Familie, dem Freundeskreis oder den Kollegen und zum anderen die Definition durch eine Gruppe vermittelt über Werte, Normen, Regeln und Vorschriften. Soziologisch kann vom Verständnis der sozialen Identität ausgehend die Konstruktion von Status, Rollen oder Image abgeleitet werden. Unter personaler Identität ist die Identifikation des Subjekts mit sich selbst zu verstehen. ähnlich definieren Frey und Haußer (1987, S. 4) Identität als Integrationsleistung diskrepanter Selbsterfahrungen, d.h. den Integrations- und Balanceaspekt zwischen externem und internem Aspekt. Dabei ist der externe Aspekt das Ergebnis externer Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse und der interne Aspekt ein reflexiver Prozess, der sich auf den Ebenen des Sozialen als Bild von der Meinung anderer über sich selbst und des privaten Selbst als Selbstinterpretation aus der eigenen Perspektive abspielt. Anders hingegen das psychoanalytische Entwicklungskonzept.
Der amerikanische Psychologe deutscher Herkunft Erik H. Erikson (1902-1994) entwickelte ein Ordnungsmodell linearer Entwicklungsverläufe, bei denen Kontinuität und Berechenbarkeit der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterstellt werden, damit subjektive Selbstfindung gelingen kann. Seine Vorstellung von Ich-Identität steht für Kontinuität und Kohärenz. Im Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung baut sich Identität durch die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben auf, denn „Das menschliche Wachstum soll hier unter dem Gesichtspunkt der inneren und äuöeren Konflikte dargestellt werden, welche die gesunde Persönlichkeit durchzustehen hat und aus denen sie immer wieder mit einem gestärkten Gefühl innerer Einheit, einem Zuwachs an Urteilskraft und der Fähigkeit hervorgeht, ihre Sache “gut zu machen”, und zwar gemäß den Standards derjenigen Umwelt, die für diesen Menschen bedeutsam ist." (Erikson 1973, S. 56)
Dieses psychoanalytische Konzept der Identität ist für ein Verständnis der Prozesse bei der Wissensweitergabe jedoch nur sehr unzureichend zu verwenden, denn die soziale Identität wird durch die lineare Entwicklung und der Betonung der Auseinandersetzung des Individuums mit den Problemen der Identität zu wenig berücksichtigt. An Bedeutung gewinnt das Verständnis der so genannten Ich-Identität jedoch wieder unter Einbeziehung der Phänomene verlängerter Adoleszenz, wie sie in der westlichen Kultur allgegenwärtig sind und sich mittlerweile je nach Perspektive bis in die Mitte der Dreißigjährigen zieht und selbst Senioren weit jenseits der 60 sich gern mit Artefakten Verhalten der Jugendlichkeit umgeben wie sportliche Kleidung oder der Besuch von Rockkonzerten. Die zentrale Phase im Hinblick auf die Identitätsbildung ist bei Erikson die Jugendphase, die er auch als "psychosoziales Moratorium" bezeichnet. Dies soll ein Entwicklungsspielraum sein, der auf den Erwachsenenstatus hinführt. Diese Phase jedoch, ist auch für das Experimentieren mit Rollen von enormer Bedeutung. Erikson schreibt, dass „die Persönlichkeit des nicht allzu neurotischen Jugendlichen (...) viele notwendige Elemente eines halb bewussten und provokanten Experimentierens mit Rollen enthält.“ (Erikson 1973, S. 143)
Dieser Vorgang bildet also einen guten Erklärungsansatz für Phänomene der Computervermittelten Kommunikation wie der spielerische Umgang mit unterschiedlichen Kommunikationsrollen oder die Betonung der Selbstverwirklichung im Umfeld kreativer Tätigkeiten, die als personale Barrieren die Wissensweitergabe behindern.
Doch grundsätzlich bleibt ein Vorbehalt psychoanalytischer aber auch sozialpsychologischer Entwicklungsmodelle wie die Entwicklungsstufen der Identität von George H. Mead, in dem Identität durch die Selbstreflexion des Individuums unter Einbeziehung der Rolleninnen- und –außensicht entsteht, bestehen, denn beide Modelle betrachten die Identitätsgenese als linearen Entwicklungsprozess, der in der Auseinandersetzung mit der primären sozialen Gruppe der Familie und weiteren zunehmend entfernteren Gruppen stattfindet. Doch in einer pluralistischen, modernen von ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten geprägten Welt birgt eine derartige Charakterisierung der Identität die Gefahr traditionelle Formen der Sozialisation als beeinflussende Faktoren zu erhalten, die in der Lebenswirklichkeit keinen oder nicht mehr jenen heraus ragenden Stellenwert haben. In der Publikation Identitäten im Internet fasst Sabine Misoch diese „Neuen Erfahrungsdimension der Individuen in der Postmoderne“ (Misoch 2004, S. 74ff) nach unterschiedlichen Kategorien zusammen.
Einbettungsgefähl der Individuen
Verhaltens- und Rollenmuster sind wesentlich durchlässiger als in starren Stände bzw. Klassengesellschaften. Auch wenn mit jeder neuen Bildungsstudie eine größere schichtspezifische Durchlässigkeit in Anbetracht ungleich besserer Bildungschancen von Akademikerkindern im Vergleich zu Arbeiterkindern in schöner Regelmäßigkeit gefordert wird, muss festgestellt werden, dass der statistische Unterschied multifaktoriell interpretiert werden muss, ja gerade vielleicht die fehlende Einbettung oder besser formuliert die größere Freiheit des Individuums mit den Folge der Gefühle des Verlorenseins oder dem fehlenden Halt durch feste Lebenszusammenhänge Faktoren sind, die den statistischen Unterschied mit erklären können. Festzuhalten ist, dass die feste soziale und örtliche Verankerung vormoderner Zeiten sich in der heutigen Gesellschaft überlebt hat.
Individualisierung
Eine große Ähnlichkeit mit dem Begriff der Einbettung weist der Begriff der Individualisierung auf, der die „Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen“ sowie die Anforderung an das Subjekt, „sein eigenes Leben zu führen“ meint (Beck und Beck-Gernsheim 1994, S. 11) Der Mensch ist in der postmodernen Gesellschaft geradezu verdammt ,auf sich selbst verwiesen zu sein, ohne dass ihm jemand die Weg bestimmenden Entscheidungen abnehmen könnte weder individuell noch abstrakt eine Klasse.
Wandel der Erwerbsstrukturen
Gerade in Deutschland war die Erwerbsarbeit lange ein identitätsbestimmender Faktor. Die soziale Identität in Organisationen ist dabei in Anlehnung an Ashforth und Mael (1989) als eine spezifische Form der sozialen Identität zu betrachten. In eine Zeit aber in der die Erwerbstrukturen einem immer schnelleren Veränderungsprozess unterworfen sind, in der auch erfolgreiche Erwerbsbiographien häufig wechselnde Beschäftigungen aufweisen, wird Identität nicht mehr durch eine Vollerwerbstätigkeit definiert, sondern durch flexible, projektorientierte Tätigkeiten. „Diese Transformation ehemals fester Stellen in befristete und projektabhängige d.h. zeitlich begrenzte Arbeitsabschnitte führt zu einer neuen Unsicherheit“ (Misoch 2004, S. 77).
Neue Wahlmöglichkeiten – Optionalität
Jedes Individuum kann sich seinen eigenen Stil zulegen. Eine zunehmende Wahlmöglichkeit in Kleidung, Ausstattung, Aussehen ja in ganzen Lebensstilen erlaubt eine Vielzahl von parallelen Lebenswelten, die sich in unterschiedlichen Riten, Verhaltensweisen und Artefakten ausdrücken. Sie sind untereinander frei gestaltbar und nicht mehr Vorgabe für Geisteshaltung. Ein besonderes Kennzeichen der Postmoderne ist die bedeutungsunabhängige Kombinierbarkeit von Signifikat und Signifikant.
Pluralisierung von Lebensmustern
Von der Gesellschaft bzw. ihren Organen gibt es kaum noch normative Ansprüche bezüglich eines eindeutiges Ausbildungs- und Lebensweges. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Lebenswegen wird gesellschaftlich akzeptiert. Die Entscheidung darüber füllt das Individuum allein. Das ist positiv und befreiend auf der einen Seite, führt zum anderen auch zu Unsicherheiten und Fluchtreaktionen vor dem Mehr an sich daraus ergebender Verantwortung.
Auflösung traditioneller Lebensformen
Das klassische Modell einer Kleinfamilie, in der die biologischen Eltern mit den biologischen Kindern in einer Wohnung zusammen leben, und das männliche Elternteil in Erwerbsarbeit den Unterhalt der Familie sichert, ist zumindest in den Großstädten einer Vielzahl von unterschiedlichen Familienkonstellation gewichen. Diese existieren parallel und ohne eine wertende Gewichtung, bewirken aber ganz verschiedene Lebenswelten und Rollenmuster.
Fragmentierung
Wir werden immer stärker Teil wachsender Netzwerke, in denen diskontinuierliche Beziehungen vorherrschen und wir zwischen verschiedenen Erfahrungen und Lebenswelten wechseln können. Keine erhebt Anspruch auf Ausschließlichkeit.
Beschleunigung
Beschleunigung kann hier begriffen werden als die technische Beschleunigung, die in immer kürzeren Habwertzeiten technische Innovationen hervorrufen, die ganz wesentlich unsere Lebenswelten beeinflussen wie die Mobilisierung des Internetzugangs in den letzten Jahren oder die flächendeckende Verbreitung von Navigationssystemen. Zum anderen aber und dies auch zum Teil Folge eines technischen Wandels, die rasante Beschleunigung des sozialen Wandels. „Verlässliche Traditionen und Gemeinschaften, Moden, Werte, Orientierungen, Wissensbestände und Handlungsmuster wandeln und verändern sich immer schneller.“ (Rosa 2002, S. 273).
Reizüberflutung
Die beständige, mehrkanalige ja manchmal sogar widersprüchliche Informationsvielfalt führt zu einem stark veränderten Verhalten. Als überfordernd wird dabei nicht nur die Permanenz der Reize empfunden, sondern auch die Forderung nach einer Präsenz bei anhaltenden Außenreizen. Dauerhafte Erreichbarkeit und die Notwendigkeit durchgehend über Twitter oder Skype, Telefon oder per SMS zu kommunizieren bilden die Grundpfeiler einer durchreizten Welt, in der ein Ereignis nur so viel wert ist, wie die Mitteilung darüber.
Verändertes Zeitempfinden
Der lineare Zeitbegriff wird durch ein polyzyklisches Verständnis von Zeit überformt. „Man kann (virtuell) zugleich an verschiedenen Orten sein und bleibt doch in der eigenen Ortszeit (RL-Zeit) gefangen.“ (Misoch 2004, S. 84)
Enträumlichung und zunehmende Relevanz virtueller Räume
Der Ort ist weder in sozialer noch in wirtschaftlicher Hinsicht noch von Bedeutung. Der rasante Zuwachs virtueller sozialer Netzwerke begleitet einen Prozess, in dem die von der Wirtschaft eingeforderte Mobilität zu neuen Formen grenzüberschreitenden Zusammenlebens führt. Der geographisch eng definierte soziale Raum transformiert zu einem sozialen Raum der entörtlicht ist. Die Abhängigkeit von den modernen mobilen Kommunikationsgeräten führt vielleicht weniger zu einer Reizüberflutung als mehr zu einer Enträumlichung, in der das Individuum mental nie dort ist, wo es sich physisch befindet.
Zunahme der Kontingenzerfahrung
Als Kontingenz wird die Ungewissheit einer Lebenssituation verstanden. Diese Ungewissheit kennzeichnet alle Lebensbereiche und begleitet die Entscheidungsfreiräume. Wir haben also mehr Freiheiten, haben aber auch ein zunehmende Unsicherheit über die Entscheidungskonsequenzen.
Unter Einbeziehung dieser zahlreichen neuen Erfahrungsdimensionen können wir weder Eriksons Modell einer psychoanalytisch geprägten Identitätsentwicklung, in der die Identitätsgenese in Stufen bis zum Erwachsenenalter verläuft, noch eine einfaches wechselseitiges Beeinflussungsmodell zwischen personaler und sozialer Identität anpassungsfrei übertragen. Identität entwickelt sich als Konstruktion eines Selbst aus Mustern und Bestandteilen. Identität wird komponiert und gesampelt, denn die Transformation traditionaler Wertvermittlungsinstitutionen wie die Familie, die Enträumlichung sozialer Lebenswelten durch soziale Netzwerke und die hohen Mobilitätsanforderungen, die durch Auflösung konventioneller Beschäftigungsstrukturen erzwungen werden, die Individualisierung der Lebenswelten und Kulturerfahrungen und nicht zuletzt die fast unbegrenzte Optionalität im demographischen Wandel. „Ich bin Viele“ sagt Sherry Turkle in ihrer Untersuchung des Sozialverhaltens von permanenten Netznutzern. Dieses Viele-Sein verlangt ein verändertes Verständnis von Identität. Einige Ansätze sind nachfolgend vorgestellt.
Goffman (Goffmann 1975) vertritt als Soziologe den Interaktionismus. In seinem Buch "Stigma über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität" beschreibt er "die Situation des Individuums, das von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist. Dies geschieht, weil im direkten Kontakt zwischen seiner "virtualen sozialen Identität" die der lnteraktionspartner antizipiert hat, und seiner "aktualen sozialen Identität" eine Diskrepanz ist, die es in unerwünschter Weise von anderen seiner Kategorie unterscheidet. Soziale Identität betrifft also die Kategorisierbarkeit eines Individuums, auf das, was auf den ersten Blick ersichtlich ist. Neben "sozialer Identität" und "persönlicher Identität" unterscheidet Goffman als dritte Perspektive die "Ich-Identität", die er als persönliche und reflexive Angelegenheit versteht, die wie ein Selbstschutz gegen Anfeindungen funktioniert. Bezogen auf die Ich-Identität eines stigmatisierten Individuums konstatiert Goffman eine besondere Ambivalenz, die im Wesentlichen davon herrührt, dass es hin- und hergerissen ist zwischen verschiedenen Identifikationsmöglichkeiten.
In dem Buch "Soziologische Dimension der Identität" (Krappmann 1969) entwickelt Lothar Krappmann den Begriff der balancierenden Identität. Er greift die Ausführungen von Goffmann auf, die sich auf Randgruppen wie Zuchthäusler, Prostituierte, Drogenabhängige etc. beziehen. Diese Gruppen haben es besonders schwer auf der Bühne des Lebens, weil ihnen Eigenschaften zugeschrieben werden und Rollenerwartungen angetragen, die es schwer machen, eine eigene Identität zu entwickeln. Die Erwartungen an ihre Rollen unterliegen negativen Zuschreibungen, so dass die Gesellschaft weniger bereitwillig mit solchen Menschen interagiert. Geht man davon aus, dass sich persönliche Identität auf die Einzigartigkeit eines Individuums bezieht, so haben diese Gruppen gerade damit ein Problem. Natürlich besteht ihre Einzigartigkeit nicht nur darin Prostituierte oder Gefängnisinsasse zu sein, aber die Gesellschaft behandelt sie so. Krappmann schreibt, das eine Möglichkeit dieser Situation zu begegnen, die balancierende Identität sei. „Was erwartet wird, ist also ein Balanceakt: eine Identität aufzubauen, die scheinbar den sozialen Erwartungen voll entspricht, aber in dem Bewusstsein, in Wahrheit die Erwartungen doch nicht erfüllen zu können." (Krappmann1969. S. 72)
Die Art und Weise dieser Balance ist individuell. Sie ist seine 'lch-ldentität'. Jede Interaktion ist ein 'Handel um Identität' unter der Fragestellung: Als wen bist du bereit mich anzuerkennen? Und als wer will (oder kann) ich mich zeigen? Keine Interaktion befriedigt alle Bedürfnisse. Deshalb muss der Einzelne, um interaktionstauglich zu sein, Ambiguitätstoleranz aufbringen. D. h. er muss es aushalten können, bei sich und anderen verschiedene Motive und verschiedene Rolleninterpretationen gleichzeitig zu dulden. Ob ein Mensch Ambiguitätstoleranz entwickeln kann, hängt von den lnteraktionsmustern in der Familie ab. Das Individuum kann seine "Rolle" nur eingeschränkt spielen, wenn es sich über seine wahren Bedürfnisse im Unklaren ist. Unter Rolle versteht Krappmann nämlich sozial definierte und institutionell abgesicherte Rollenerwartungen, die interpretiert werden müssen. Das "Wie" der Rolleninterpretation ist die Präsentation von Ich-Identität. Die Rollenerwartungen sind nämlich nicht so fix, dass sie dem Individuum nicht lnterpretationsspielraum ließen.
Keupp et al (1999) entwickelten auf Basis einer Langzeitstudie eine Theorie der Identität, in der sie die Identität als Patchwork bezeichnet haben. Hier wird Identität zu einer Konstruktionsaufgabe, in der die Individuen wie Architekt und Bauherr gleichzeitig aus Fragmenten und Teilelementen ihre Identitäten frei zusammenstellen können. Doch diese Freiheit kennt auch die Kehrseite der Pflicht auf eine sich wandelnde, zunehmend komplexer werdende Gesellschaft reagieren zu müssen. „Die Vorstellung von Identität als einer fortschreitenden und abschließenden Kapitalbildung wird zunehmend abgelöst von der Idee, dass es bei Identität um einen Projektentwurf des eigenen Lebens (...) geht, oder um die Abfolge von Projekten, wahrscheinlich sogar um die gleichzeitige Verfolgung unterschiedlicher und teilweise widersprüchlicher Projekte, die in ihrer Multiplizität in ganz neuer Weise die frage nach Kohärenz und Dauerhaftigkeit bedeutsamer Orientierungen des Lebens stellen.“ (Keupp et al. S. 30)
Ob nun die Interaktionstheoretischen Ansätze von Goffman oder Krappmann oder die Theorien zur Flexibilisierung des Selbst wie Keupp et al. und der Multiplizität wie Turkle Identität ist kein monolithisches Monument, sondern eher eine Konstruktion, in der Selbstwahrnehmung und Fremdzuschreibungen unterschiedlicher sozialer Gruppen, Fassaden, Räume und Stockwerke ausformen, die keinen Abschluss haben, sich hingegen in fortwährendem Veränderungsprozess befinden. Vor diesem Hintergrund ist die weiterhin häufig angeführte Dichotomie zwischen Netz- und Realwelt wenig hilfreich. Nicola Döring schreibt in diesem Zusammenhang: „In der eigenen Identitätskonstruktion nicht auf wenige, an Äußerlichkeiten festgemachten Rollen fixiert zu sein, sondern sich gemäß eigenen Gefühlen und Interessen flexibel neu zu entwerfen, ist mehr als ein unterhaltsames Gesellschaftsspiel. (...) Gerade in spät- oder postmodernen Gesellschaften, in denen universale Lebenskonzepte abgedankt haben und Menschen mit diversifizierten und individualisierten Umwelten und Lebenswegen konfrontiert sind , bietet der Umgang mit virtuellen Identitäten ein ideales Lern- und Entwicklungsfeld für Selbsterkundung und Identitätsarbeit. Nicht nur können Netzkontexte kompensatorisch die Möglichkeit bieten, Teilidentitäten kennenzulernen und auszugestalten, die im Offline-Alltag zu kurz kommen. Netzerfahrungen können auch als Probehandeln Verhaltensänderungen außerhalb des Netzes vorbereiten und tragen nicht zuletzt dazu bei, die Mechanismen der Identitätskonstruktion besser zu verstehen.“ (Döring 2003)
Anwendung
Ein spielerischer Umgang mit Verhaltensmustern, Rollen und Selbst-Bildern ist Bestandteil unseres pluralistischen, fragmentierten, beschleunigten Alltags. Wer Wissen weiter gibt, will sich in der Rolle des Wissensakteurs gefallen und nicht als Prozesselement eines anonymen Wissensmanagementsystems betrachtet werden. Stegbauer (2009, S. 125f) konnte nachweisen, in welchem Maße die Positionsbestimmung, also der Prestigegewinn durch die Einnahme einer Rolle, auf das Verhalten der aktiven Wikipedianer einwirkt. Für die Arbeit in virtuellen Organisationen stellt Büssing (2003, S. 68) fest, dass Identität und Vertrauen ganz grundlegend für den Erfolg von virtuellen Unternehmensstrukturen sind. Hier verweist er insbesondere auf die Bedeutung von Wissensarbeit in Netzwerken. Die Stärkung oder Bildung von Identität und damit auch Vertrauen in neuen, nicht starren Organisationsformen müssen dabei von unterschiedlichen Parametern ausgehen. Die Festlegung auf eine gemeinsame unternehmensweite Zielorientierung im Sinne einer übergreifenden organisationalen Identität (Corporate Identity) kann eben nicht ausschließlich als ein Top Down Instrument zur Optimierung der Kernprozesse betrachtet werden, sondern ebenso als Synthese der Identitäten oder Rollen der festen und freien Mitarbeiter. „Darüber hinaus werden spezifische Strategien zur Bildung und Aufrechterhaltung von Identität und Vertrauen entwickelt. Wir wissen dies von umfassenden Programmen global agierender Unternehmen (z.B. Siemens AG) oder von einzelnen Projekten (z.B. "Telecommuting Simulation Lab" des Finanz- und Wirtschaftsberaters Merrill-Lynch), in deren Rahmen die Fähigkeit von Mitarbeitern untersucht und erprobt wird, in dezentralen Telearbeitsplätzen ausreichend Selbstorganisation einerseits und Identitfikation mit den Unternehmen andererseits zu gewährleisten." (Büssing 2003, S. 69)
© Thomas Sakschewski
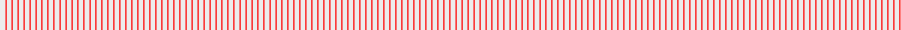
Literatur | Links
Frey, H.-P. / Hausser, K.(Hrsg.) 1987: Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart: Enke
Erikson, Erik H. 1973: Identität und Lebenszyklus. 2. Aufl. Frankfurt a/M:Suhrkamp.
Ashforth, B. / Mael, F. 1989: Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14: 20-39.
Misoch, Sabina 2004: Identitäten im Internet. Selbstdarstellung auf privaten Homepages. Konstanz: UVK
Beck, Ulrich /Beck-Gernsheim, Elisabeth 1994: Riskante Freiheiten. Zur Individualisierung der Lebensformen in der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.
Rosa, Hartmut 2002: Zwischen Selbstthematisierungszwang und Artikulationsnot? Situative Identität als Fluchtpunkt von Individualisierung und Beschleunigung. In: Jürgen Straub / Joachim Renn (Hrsg.): Transitorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst. Frankfurt am Main: Campus
Turkle, Sherry 1999: Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet. Hamburg:Rowohlt.
Goffman, Erving 1975: Stigma: über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Krappman, Lothar 1969: Soziologische Dimensionen der Identität: Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart: Klett-Cotta
Keupp et al. 1999: Identitätskonstruktionen: Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Hamburg:Rororo
Döring, Nicola 2003: Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
Stegbauer, Christian 2009: Wikipedia - Das Rätsel der Kooperation. Bielefeld: VS Verlag.
Büssing, Andre: Identität und Vertrauen durch Arbeit in virtuellen Organisationen. In: Udo Thiedeke (Hrsg.) 2003: Virtuelle Gruppen. Charakteristika und Problemdimensionen. 2. Aufl. Wiesbaden: Gabler