Computervermittelte Kommunikation
Computervermittelte Kommunikation - E-Mail
Relevanz oder Quantität?
Journalisten oder Wissenschaftler müssen an der Hürde der Gatekeeper und ihrer Qualitätskontrolle vorbei, wollen sie ihre Werke veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, ob es solche Gatekeeper auch im Internet gibt. Clay Shirky (2005) sagt dazu: “The Web has an editor, it’s everybody”. Eine Qualitätskontrolle des Contents findet statt – jedoch erst nach seiner Veröffentlichung. Je mehr Nutzer ein Dokument taggen, desto mehr Relevanz scheint dieses Dokument für sie zu haben. Ist dies aber eine ernstzunehmende Qualitätskontrolle? Wird etwas zu „geprüfter“ Qualität, nur weil viele Leute dies so sehen? (Wenn viele Studenten bei einer Mathematikklausur die gleiche – falsche – Lösung bringen, wird diese nicht dadurch qualitativ wertvoll, sondern bleibt falsch. Quantität bedeutet nicht Qualität. Andererseits weist es in eine bestimmte Richtung, wenn viele Nutzer ein Stück Information mit stupid und ein anderes mit cool taggen. Dieser Content könnte für das Relevance Ranking verwertet werden.
// Peters, Isabella / Stock, Wolfgang G. 2008: Folksonomien in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. Information - Wissenschaft & Praxis. 59(2008)2. S. 81
Glocalisation
We find community in networks, not groups (...) In networked societies: boundaries are permeable, interactions are with diverse others, onnections switch between multiple networks, and hierarchies can be flatter and recursive (...) Communities are far-flung, loosely-bounded, sparsely-knit and fragmentary. Most people operate in multiple, thinly-connected, partial comunities as they deal with networks of kin, neighbours, friend, workmates and organizational ties. Rather than fitting into the same group as those around them, each person his/her own personal community. (...) Huge increase(s) in speed (have) made door-to-door comunications residual, and made most communications place-to-place or person-to-person. (...) The household is what is visited, telephoned or emailed.
// Wellman, Barry 2001: Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. In: International J. Urban and Regional research. Jg. 25. S 227-252. S. 233f
Ontologische Bodenlosigkeit
Das Leben in der Wissens-, Risiko-, Ungleichheits-, Zivil-, Einwanderungs-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft verdichtet sich zu einer verallgemeinerbaren Grunderfahrung der Subjekte in den fortgeschrittenen Industrieländern: In einer "ontologischen Bodenlosigkeit", einer radikalen Enttraditionalisierung, dem Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten. Subjekte erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige Drehbücher geliefert würden. Genau in dieser Grunderfahrung wird die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar. Es klingt natürlich für Subjekte verheißungsvoll, wenn ihnen vermittelt wird, dass sie ihre Drehbücher selbst schreiben dürften, ein Stück eigenes Leben entwerfen, inszenieren und realisieren könnten. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Chance auch realisiert werden können, sind allerdings bedeutend. Die erforderlichen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen sind oft nicht vorhanden und dann wird die gesellschaftliche Notwendigkeit und Norm der Selbstgestaltung zu einer schwer erträglichen Aufgabe, der man sich gerne entziehen möchte. Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu inszenieren, hat ohne Zugang zu der erforderlichen Ressourcen, etwas zynisches.
// Keupp, Heiner 2003: Identitätskonstruktion. Vortrag bei der 5. bundesweiten Fachtagung zur Erlebnispädagogik am 22.09.2003 in Magdeburg; Online im Internet: www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf (29.06.2010)
Why People Choose Work Group Members?
In our study, people are choosing group members for future projects based on people’s reputation for competence. People may not actually know each other’s grades or the number of hours put in on previous projects, but it is clear that a reputation for competence is developed and circulates within the organization. Further, it is an important basis on which people develop their preferences for future group members. It is interesting to note that grade point average was not a significant predictor of being chosen as a team member. This may indicate that people do not choose others based on general indicators of competence or that information on grade point average and general competence circulate less freely in these groups or are harder to assess.
Finally, we hypothesized that people would choose others with whom they were already familiar for future work groups. This hypothesis was partially supported. But, our analysis indicates that familiarity alone is not adequate to generate a future work tie. During the course of project 1, people established working relationships with others in their group. These relationships varied over time, but on average, each person had either a strong or weak tie with each other member in his or her current group. Where there were strong ties, people elected to continue those relationships in future work groups. This is consistent with Kilduff’s (1990) finding that MBA students, when they look for jobs, want to work in the same companies as their friends. These data suggest that familiarity may lead to an awareness of whether or not an ongoing working relationship is effective. If a relationship is successful, then people are especially inclined to repeat it. This is consistent with our argument that people are seeking to reduce uncertainty in their choice of future group members. Although there may be better group members in the organization, people are choosing a “sure thing” rather than taking the risk of working with someone who has a work style and work ethic with which they do not have personal experience.
// Hinds, Pamela J. / Carley, Kathleen M. / Krackhardt, David/ Wholey, Doug 2000: Choosing Work Group Members: Balancing Similarity, Competence, and Familiarity In: Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 81, No. 2, March, S.
![]()

Community of Practice
Die Wissensgemeinschaft, die Community of Practice, wird von vielen Autoren als Grundlage des Wissensaustausches begriffen. Doch in welcher Beziehung steht die Community of Practice mit der regulären Gruppen- oder Teambildung im Arbeitsalltag? Wenn aber jede Kooperation bei Projekten, wenn jedes Team in der Veranstaltungsplanung und –organisation schon eine Wissensgemeinschaft darstellen könnte, wie trennscharf kann der Begriff dann sein oder wird nur angenommen, dass innerhalb der Gruppenbildungs- und Kommunikationsprozesse sozusagen automatisch Wissen „erzeugt“ wird? In dem Beitrag wird überprüft, ob der Begriff der Community of Practice angesichts delokalisierter Arbeitswelten und wechselnder (virtueller) Gemeinschaften in der Veranstaltungsbranche noch Anwendung finden kann.
Begriffsklärung
Lave und Wenger 1991 betrachten eine Community of Practice als eine „intrinsic condition fort he existence of knowledge (...). Thus, participation in the cultural prcatice in which any knowledge exists is an epistmological principal of learning. The social structure of this practice, its power relations, and ist conditions for legitimacy define possibilities for learning (...).“ Diese erkenntnistheoretische Grundlage für das Lernen wird von Wenger, McDermott und Snyder (2002) definiert als eine „unique combination of three fundamental elements: a domain of knowledge, which defines a set of issues; a community of people who care about this domain; and the shared practice that they are developing to be efective in their domain.“ Diese sehr allgemeine Auffassung wird in der Definition von North, Romhardt und Probst (2000. S. 54) wesentlich präziser gefasst. Danach sind Communities of Practice „über einen längeren Zeitraum bestehende Personengruppen, die Interesse an einem gemeinsamen Thema haben und Wissen gemeinsam aufbauen und austauschen wollen. Die Teilnahme ist freiwillig und persönlich. Communities of Practice sind um spezifische Inhalte gruppiert.” ähnlich beschreiben auch Wenger und Snyder die Wissensgemeinschaft in einer späteren Begriffsbestimmung (Wenger und Snyder 2000, S. 4): „Communities of Practice are groups of peeople who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis.“ Auch hier stehen etwas indifferent - und nur durch die Verneinung einer nur kurzen Zeitspanne - die Dauer und das Thema im Vordergrund.
Die Gemeinschaft wird im Wesentlichen in ihrer Abgrenzung zur formalen Organisation des Unternehmens verstanden, meint also ein soziales System, das sich als eine informelle Struktur jenseits formaler Grenzen findet. Dabei ist zu beachten, dass Gemeinschaften wie auch Gruppen ein Mindestmaß an Kohäsion benötigen, um Außengrenzen zu definieren und nach innen sich am Anderen wieder zu erkennen. Die informellen Strukturen oder sich heraus bildenden Gemeinschaften können unsichtbar sein wie in dem von Brown und Duguid (Brown und Duguid 1991. S. 49) beschriebenen Austauschprozess bei Xerox, bei dem es den Technikern gelang, Wissensinhalte und die grundlegenden Lernbedingungen in der informellen Wissensgemeinschaft wiederzugeben und zu teilen. Sie können sogar den Interessen und expliziten Zielen des Unternehmens widersprechen wie bei Krackhardt und Hanson (1994). Wenger et al. (2002) unterscheiden fünf Formalisierungsgrade:
1. Unrecognized, für eine unsichtbare Wissensgemeinschaft,
2. Bootlegged, ist nur einen ausgewählten Kreis von Personen bekannt,
3. Legitimized, die Wissensgemeinschaft wird in der Organisation als wertvoll anerkannt,
4. Strategic sie besitzt eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen und
5. Transformative, die Wissensgemeinschaft kann in sich begrenzt sein, ist jedoch in der Lage und in der Position die Organisation in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Jede Gemeinschaft braucht ein Zentrum, um das es sich formiert. Dieses Zentrum kann sich in gemeinsam gemachten Erfahrungen und Erlebnissen widerspiegeln, in erlernten sozialen Praktiken und Verhaltensweisen oder einem explizit formulierten Projektziel. Bei einer Community of Practice ist dies ein gemeinsames Interesse an einem Thema (Frost und Holzwarth 2001. S. 52; North, Romhard und Probst 2000. S. 54; Hagel und Armstrong 1997 oder Wenger und Snyder 2000. S. 139). Diese gemeinsamen Themen können in geteilten Erfahrungen mit Produkten und Dienstleistungen bestehen, ein gemeinsames Problem, gemeinsame fachliche, praxisorientierte und wirtschaftliche Themenstellung oder nur die gleiche Arbeit. Die informelle, freiwillige, nicht fremdbestimmte Mitgliedschaft ist das zentrale Prinzip einer Community of Practice (Bullinger u. a. 2002. S. 23). Die Entscheidung der Teilnahme ist in beiden Richtungen freiwillig, denn die Gemeinschaft entscheidet als Ganzes, wer teilnehmen darf, und das Mitglied selbst entscheidet, ob es an der Community teilnehmen will. Als längerer Zeitraum wird ein Zeitraum verstanden, der nicht begrenzt ist und über einen zeitweiligen, kurzfristigen Kontakt hinausgeht. Analog den Gruppenbildungsprozessen entwickeln sich über einen Zeitraum Rollen und Kommunikationsverhalten, die das Bild und die Wirksamkeit der Gemeinschaft wesentlich mitbestimmen und sich einmal etabliert, dauerhaft stabilisieren. Die Mitglieder organisieren sich freiwillig und interagieren miteinander. Durch die Interaktion der Mitglieder untereinander, arbeiten die Mitglieder an der Wertschöpfung der Gemeinschaft mit, womit sie vom einfachen Konsumenten zum Co-Produzenten, nach Bullinger et al. (2002) zum Prosumenten werden. Der Prosument in der Wissensgemeinschaft empfängt, also konsumiert gleichzeitig Wissen und erzeugt, also produziert Wissen.
Was aber findet eigentlich in einer Wissensgemeinschaft statt?
Der Austausch der Mitglieder, der Aufbau einer gemeinsamen Sprache zur Erzeugung einer gemeinsamen Wissensbasis, der Wechsel von Wissensgenerierung und der Transformation in Handlungen, also der lebendige, sprachlich kodierte Austausch von Erfahrungen innerhalb einer Wissensgemeinschaft sind die Elemente, die in diesem Zusammenhang häufig genannt werden. Dabei wird angenommen, dass Wissen über Kommunikation erzeugt wird, dass also all die Verhaltensmuster, Typologien und das eingespielte Rollenverhalten, das ein grundsätzlicher Effekt von gemeinschaftlichen Entwicklungsprozessen ist, wirken, um Lernprozesse in Gang zu setzen, die es den Einzelnen ermöglichen in einem durch Vertrauen geprägten Umfeld, das auf Freiwilligkeit und Gemeinsamkeiten beruht, implizites Wissen zu explizieren. Stacey (2001) betont in diesem Zusammenhang die Kontextgebundenheit von Lernprozessen bei der Lösung von realen Problemen. Dabei entstehe, so Stacey, Wissen durch Interaktionsprozesse zwischen Menschen. Dieses Wissen kann aber nicht irgendwo gespeichert werden, sondern findet einen Ausdruck in dem Verhalten und den Artefakten der Mitglieder, wird also nur zum Teil transparent und für Externe dekodierbar. Die Interaktion der Mitglieder kann in Abh?ngigkeit von der Art der Organisation, den Zielen oder den allgemeinen Rahmenbedingungen auf Basis computervermittelter Kommunikation oder durch Face-to-Face Kontakte erfolgen, also virtuellen oder persönlichen Charakter haben. Schon aufgrund der Zeitdauer und den Beschränkungen asynchroner Kommunikation wird zumindest sporadisch eine Kommunikation Face-to-Face, denn Gespräche bilden die Grundlage für die Entwicklung von Individuen und Organisationen sowie die Entstehung eines gemeinsamen Standpunktes. Ebenso wie die Kommunikation können auch Ereignisse einer Community of Practice persönlich oder virtuell z.B. durch Einladung in ein gemeinsames Webinar oder Videokonferenz via Skype stattfinden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass Gemeinschaften dann effizient über computervermittelte Medien kommunizieren und auch Ereignisse schaffen können, wenn vorab schon eine Verbindung geschaffen wurde, die in reality erlebt wurde, dann können kontinuierliche Aktivitäten ebenso wie einmalige Anlässe real oder virtuell durchgeführt werden.
Funktionen von Wissensgemeinschaften
Nach Wenger (1998) ergeben sich für Wissensgemeinschaften gleich mehrere Funktionen zur Schaffung, Akkumulation und Verteilung von Wissen in Organisationen und über Organisationsgrenzen hinweg:
Communities of Practice sind Verbindungsglieder für den Austausch und die Interpretation von Informationen, denn da die Mitglieder von Wissensgemeinschaften ein gemeinsames Verständnis haben von einem Thema, wissen sie, was relevant ist zum Weitergeben und Bekanntmachen und wie die Informationen in nützlicher Art und Weise präsentiert werden können. Daher bilden Wissensgemeinschaften eine ideale Voraussetzung, um auch Informationen über Organisationsgrenzen hinaus zu verbreiten. In diesem Sinne gleichen Wissensgemeinschaften Redaktionen in einem Nachrichtenmedium. Auf dieses Konzept beruht auch der Aktuelle Trend eines user ranked contents. in dem auf einer Plattform Inhalte gesichtet, bewertet und empfohlen werden. Hier verwischen sich zunehmend die Grenzen zwischen den traditionellen, klassischen Medien, die sich durch ihren expert review bzw. peer review legitimieren und dem collaborative ranking, das ja kein Maß der Qualität, sondern nur der Quantität der Clicks, Downloads bzw. Trackbacks darstellt.
Wissensgemeinschaften können durch Ihren gesprächsorientierten Charakter Wissen lebendig halten, denn im Gegensatz zu Datenbanken oder Manuals, werden auch die impliziten Elemente von Wissen erhalten, wen auch die Weitergabe nicht problemfrei ist. Lebendig sind Wissensgemeinschaften aber insbesondere, da sie sich aktuellen Veränderungen leichter anpassen können als dies mit starren informationsorientierten Systemen möglich ist.
Die durch gemeinschaftliche Erfahrungen und Erkenntnisse hohe Gruppenkohäsion und die sich durch Freiwilligkeit und Selbstorganisation ergebende, stärkere Identifikation mit der Wissensgemeinschaft, der Themenstellung und den Mitgliedern, fürdert den Aufbau und die Entwicklung neuer Kompetenzen, die in die Organisation hinein wirken. Ob Wissensgemeinschaften wie Wenger an dieser Stelle meint, wirklich oft schneller und weniger schwerfällig als Geschäftseinheiten sind, hängt hingegen stark von der Größe und Komplexität der Organisation sowie Form und Hierarchietiefe der Gliederungsstruktur ab.
„Wissensgemeinschaften bilden eine Heimat für Identitäten“, stellen North, Franz und Lembke (2004. S. 9) pointiert fest und zielen dabei auf die große Bedeutung selbstorganisierten Lernens von Individuen in Zeiten, in denen Projekte, kurzfristige Teams und Zuordnungen zu Geschäftseinheiten immer schneller wechseln, da längerfristig Wissensgemeinschaften eine fachliche Identität für ihre Mitglieder bilden und weisen des weiteren darauf hin, „dass in Zeiten flacherer Hierarchien Wissensgemeinschaften ein Experimentier-, ein Lernfeld bilden, in dem Mitarbeiter offen Ideen austauschen können.“ (North, Franz und Lembke 2004. S. 9). Der Ansatz des situativen bzw. sozialen Lernens wird dabei im Kontrast zu einer traditionellen Sicht des Lernens bzw. der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen von den Mitgliedern bewusst erlebt.
Anwendung
North, Franz und Lembke (2004. S. 88ff) untersuchen in dem detaillierten Forschungsbericht, ob virtuelle Gemeinschaften automatisch als Wissensgemeinschaften gelten können. Dafür ergänzen und erweitern sie das MIEO-Modell und überpr?fen, ob die dort in Beziehung gesetzten Gestaltungsdimensionen Mitglieder, Interaktion, Ergebnis und Organisatorische Unterstützung in der gelebten Praxis bestehender Gemeinschaften wirksam eingesetzt werden. Hierfür haben sie 43 Fallbeispiele genauer untersucht, darunter Informations-Nutzungs-Communities, Virtuelle Communities, organisationsinterne und -externe Communities of Practice, Learning Communties und Sales & Support Communities.
Hinsichtlich der Mitglieder wurden Aussagen über die Motivation der Teilnehmer, Zugehörigkeit von Teilnehmern an der Community, das Maß der Identifikation und Niveau der beteiligten Experten, der Grad der Wissensdiversität und der Grad der Aktivitäten zur Gewinnung von Mitgliedern. Die Berücksichtigung der organisatorischen Gestaltungsdimension, d. h. der Verankerung der Community-Aktivitäten an ausgesuchten Geschäftsprozessen wurde an folgenden Merkmalen fest gemacht: Der Grad der Formalisierung intern, der Umfang der Begrenzungen für Aktivitäten und Prozesse, die Dauer der Community-Aktivitäten und der Umfang der eingesetzten Tools bzw. Instrumente.
Bei den Ergebnissen wurden insbesondere das grundsätzliche Ziel einer Wissensgemeinschaft betrachtet, nämlich der Wissensaustausch zwischen den Mitgliedern durch Interaktionen. Konkret wurde untersucht, welche Interaktionen zu nachvollziehbaren Ergebnissen führten, wie die Qualität und Quantität der Wissensexplizierung in den betrachteten Gemeinschaften war und welchen Nutzen die Mitglieder durch ihre Zugehörigkeit erhielten. Die Interaktionen wurden anhand der Merkmale Kommunikationsform, Atmosphäre, Identität der Mitglieder mit der Community, Aufbau von Vertrauen, Entwicklung gemeinsamer Werte und Koordination eines Rhythmus der Community betrachtet.
Auch wenn aus der Vielzahl der einzelnen Fallbeispiele sich kaum eine einzelne Zusammenfassung ableiten lässt, so wird doch klar, dass nicht jede Online Community automatisch eine Wissensgemeinschaft darstellt und dass ganz unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen Gestaltungsdimensionen wirken und nicht alle auch bewusst eingesetzt werden. Dennoch gelingt es den Autoren ihre Ergebnisse in einigen, wenigen Regeln zusammenzufassen, die für alle betrachten Fallbeispiele gleichermaßen gelten.
Eine erfolgreiche Wissensgemeinschaft braucht: (North, Franz und Lembke 2004. S. 191)
„einen Kämmerer: mindestens eine Person, die mit Engagement und Charisma die Gruppe zusammenhält, neue Mitglieder gewinnt und für Vertrauensbildung sorgt;
ein Thema: ein klar beschreibbares und auch abgrenzbares Thema, das für alle Mitglieder attraktiv ist und Interesse auch längerfristig aufrecht erhalten kann;
eine Mailing-Liste: zur Kommunikation der Mitglieder untereinander und unkompliziertem Infoaustausch;
regelmäßige Veranstaltungen: möglichst gut merkbare und konstant eingehaltene Termine (z. B. dritter Donnerstag im Monat), Round Tables, Vorträge;
Weiterentwicklung der Grundelemente:
eine Website, Publikationen, Newsletter: eine Möglichkeit, Ergebnisse, Fragen, Anregungen zu dokumentieren und als Community auch nach außen zu wirken;
eine jährliche Großveranstaltung: ermöglicht, alle Mitglieder zusammenzubringen und zu zeigen `Wir sind wer!?“
Weniger gut belegt, aber sehr praxisorientiert sind die Empfehlungen zahlreicher Ratgeber zum Aufbau einer Community. Dabei beziehen sich die Ratgeber sehr wohl auf die Gestaltungsdimensionen von Wissensgemeinschaften und ergänzen diese durch allgemeine Erkenntnisse der Netzwerktheorie und der Organisationslehre. Amy Jo Kim (Kim 2001) empfiehlt z.B. neben der präzisen Zielsetzung, wie sie bei allen Projekten erforderlich ist, die Betonung der Mitglieder über einfach zu bedienende, persönliche Tools, die Interaktion über Mechanismen der Kommunikation und Profilnutzung sowie die Steuerung und Weiterentwicklung der Gemeinschaft über rollen und Ergebnisse in Form von gemeinsamen Veranstaltungen oder Wettbewerbe.
Transfer
Das Modell zur Wissenserzeugung und des Wissensaustausches durch Wissensgemeinschaften bildet eine wichtige Ergänzung zu den netzwerktheoretischen Betrachtungen (virtueller) sozialer Netzwerke. Die im MIEO-Modell aufgeführten Gestaltungsdimensionen gelten durch die Grundlagen der Freiwilligkeit und der Selbstorganisation in großem Maße für die unter Web 2.0 subsummierten Phänomene des so genannten sozialen Netzes. Vielleicht in stärkerem Maße als für organisationsinterne Wissensgemeinschaften, da hier die Grundlage der Freiwilligkeit problematisch ist und durch zu starke Kontrolle bzw. organisationsdefinierte Zielbestimmung immer wieder an Legitimationsgrenzen gerät. Der Pfad zwischen organisatorischer Unterstützung und strenger Ergebnisorientierung im Sinne der Organisation ist schmal. Gerade die Ergebnisse der untersuchten Fallbeispiele unterstützen die Ansätze den eigentlich unmöglichen Erfolg der größten, bestehenden Wissensgemeinschaft, von Wikipedia, aus der Position der einzelnen Akteure zu erklären, denn diese Vielzahl von „Kämmerer“ sind diejenigen, die das gemeinsame Thema, wir sind die weltweit größte offene Online Bibliothek, am Leben erhält und die tagtäglich über ihre Artikel und Artikelbearbeitungen in Interaktion mit allen anderen Mitgliedern stehen.
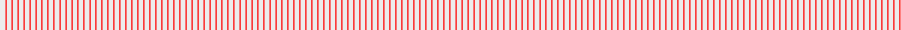
Literatur | Links
- Lave, J. / Wenger, E. 1991: Situated learning Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge Press
- Wenger, E. / McDermott, R. / Snyder, W. 2002: Cultivating Communities of Practice. A Guide to Managing Knowledge. Boston
- North, K. / Romhardt, K. / Probst, G. J. B. 2000: Wissensgemeinschaften – Keimzellen lebendigen Wissensmanagements. In: io-Management, 7/8, 2000. S. 52-62
- Wenger, E. / Snyder, W. 2000: Communities of Practice: The organizational frontier. In: Harvard Business Review, Nr. 1, January-February 2000, S. 139-145
- Brown, J.S. und Duguid, P 1991: Organizational Learning and Communities of Practice: a unified View of Working, Learning and Innovation. Organization Science 2(1). S. 40-56.
- Krackhardt, D.; Hanson, J. R. 1994: Informelle Netze – die heimlichen Kraftquellen. In: Harvard Business Manager. Nr. 1, 1994. S. 16-24
- Frost, B. / Holzwarth, C. 2001: Motivieren in Communities of Practice – Erfahrungen und Ansätze der Siemens AG. In: new management, No. 10, 2001, S. 74-80
- Hagel, J.; Armstrong, A. 1997: Net Gain – Profit im Netz:M?rkte erobern mit virtuellen Communities. Wiesbaden: Gabler.
- Bullinger, H.-J. / Baumann, T. / Fröschle, N. / Mack, O. / Trunzer; T. / Waltert, J. 2002: Business Communities – Professionelles Beziehungsmanagement von Kunden, Mitarbeitern und B2B-Partnern im Internet. Bonn: Galileo Business.
- Stacey, R. D. 2001: Complex Responsive Processes in Organizations – Learning and knowledge creation. New York
- Liedtka, J. 1999: Linking Competitve Advantage with Communities of Pratice. In: Journal of Management Inquiry. Vol. 8. No. 1 / 1999. S. 5-16
- Wenger, E. 1998: Communities of Practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge Press
- North, Klaus / Franz, Michael / Lembke, Gerald 2004: Wissenserzeugung und -austausch in Wissensgemeinschaften Communites of Practice. Quem-report, Heft 85. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Betriebl. Weiterbildungsforschung
- Amy Jo Kim 2002: Community Building. Strategien für den Aufbau erfolgreicher Web-Comunities. Bonn: Galileo