Social Tagging - Social Bookmarking
Relevanz oder Quantität?
Journalisten oder Wissenschaftler müssen an der Hürde der Gatekeeper und ihrer Qualitätskontrolle vorbei, wollen sie ihre Werke veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, ob es solche Gatekeeper auch im Internet gibt. Clay Shirky (2005) sagt dazu: “The Web has an editor, it’s everybody”. Eine Qualitätskontrolle des Contents findet statt – jedoch erst nach seiner Veröffentlichung. Je mehr Nutzer ein Dokument taggen, desto mehr Relevanz scheint dieses Dokument für sie zu haben. Ist dies aber eine ernstzunehmende Qualitätskontrolle? Wird etwas zu „geprüfter“ Qualität, nur weil viele Leute dies so sehen? (Wenn viele Studenten bei einer Mathematikklausur die gleiche – falsche – Lösung bringen, wird diese nicht dadurch qualitativ wertvoll, sondern bleibt falsch. Quantität bedeutet nicht Qualität. Andererseits weist es in eine bestimmte Richtung, wenn viele Nutzer ein Stück Information mit stupid und ein anderes mit cool taggen. Dieser Content könnte für das Relevance Ranking verwertet werden.
// Peters, Isabella / Stock, Wolfgang G. 2008: Folksonomien in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. Information - Wissenschaft & Praxis. 59(2008)2. S. 81
Glocalisation
We find community in networks, not groups (...) In networked societies: boundaries are permeable, interactions are with diverse others, onnections switch between multiple networks, and hierarchies can be flatter and recursive (...) Communities are far-flung, loosely-bounded, sparsely-knit and fragmentary. Most people operate in multiple, thinly-connected, partial comunities as they deal with networks of kin, neighbours, friend, workmates and organizational ties. Rather than fitting into the same group as those around them, each person his/her own personal community. (...) Huge increase(s) in speed (have) made door-to-door comunications residual, and made most communications place-to-place or person-to-person. (...) The household is what is visited, telephoned or emailed.
// Wellman, Barry 2001: Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. In: International J. Urban and Regional research. Jg. 25. S 227-252. S. 233f
Ontologische Bodenlosigkeit
Das Leben in der Wissens-, Risiko-, Ungleichheits-, Zivil-, Einwanderungs-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft verdichtet sich zu einer verallgemeinerbaren Grunderfahrung der Subjekte in den fortgeschrittenen Industrieländern: In einer "ontologischen Bodenlosigkeit", einer radikalen Enttraditionalisierung, dem Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten. Subjekte erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige Drehbücher geliefert würden. Genau in dieser Grunderfahrung wird die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar. Es klingt natürlich für Subjekte verheißungsvoll, wenn ihnen vermittelt wird, dass sie ihre Drehbücher selbst schreiben dürften, ein Stück eigenes Leben entwerfen, inszenieren und realisieren könnten. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Chance auch realisiert werden können, sind allerdings bedeutend. Die erforderlichen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen sind oft nicht vorhanden und dann wird die gesellschaftliche Notwendigkeit und Norm der Selbstgestaltung zu einer schwer erträglichen Aufgabe, der man sich gerne entziehen möchte. Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu inszenieren, hat ohne Zugang zu der erforderlichen Ressourcen, etwas zynisches.
// Keupp, Heiner 2003: Identitätskonstruktion. Vortrag bei der 5. bundesweiten Fachtagung zur Erlebnispädagogik am 22.09.2003 in Magdeburg; Online im Internet: www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf (29.06.2010)
Why People Choose Work Group Members?
In our study, people are choosing group members for future projects based on people’s reputation for competence. People may not actually know each other’s grades or the number of hours put in on previous projects, but it is clear that a reputation for competence is developed and circulates within the organization. Further, it is an important basis on which people develop their preferences for future group members. It is interesting to note that grade point average was not a significant predictor of being chosen as a team member. This may indicate that people do not choose others based on general indicators of competence or that information on grade point average and general competence circulate less freely in these groups or are harder to assess.
Finally, we hypothesized that people would choose others with whom they were already familiar for future work groups. This hypothesis was partially supported. But, our analysis indicates that familiarity alone is not adequate to generate a future work tie. During the course of project 1, people established working relationships with others in their group. These relationships varied over time, but on average, each person had either a strong or weak tie with each other member in his or her current group. Where there were strong ties, people elected to continue those relationships in future work groups. This is consistent with Kilduff’s (1990) finding that MBA students, when they look for jobs, want to work in the same companies as their friends. These data suggest that familiarity may lead to an awareness of whether or not an ongoing working relationship is effective. If a relationship is successful, then people are especially inclined to repeat it. This is consistent with our argument that people are seeking to reduce uncertainty in their choice of future group members. Although there may be better group members in the organization, people are choosing a “sure thing” rather than taking the risk of working with someone who has a work style and work ethic with which they do not have personal experience.
// Hinds, Pamela J. / Carley, Kathleen M. / Krackhardt, David/ Wholey, Doug 2000: Choosing Work Group Members: Balancing Similarity, Competence, and Familiarity In: Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 81, No. 2, March, S.
![]()

Socialization - Externalization - Combination - Internalization
Das Spiralmodell des Wissens (Socialization - Externalization - Combination - Internalization) von Nonaka und Takeuchi kann wohl als das am häufigsten zitierte Konzept der Entstehung organisationalen Wissens betrachtet werden. Als Standardmodell für die Entstehung, Weitergabe und Entwicklung von Wissen bildet das SECI Modell eine Grundlage zur Beschreibung der Explizierung von implizitem Wissen. Dabei bleibt zu fragen, ob das Modell in flexiblen Beschäftigungsverhältnissen mit einem hohen Anteil an externen Kräften ebenfalls anwendbar ist.
Begriffsklärung
Das Spiralmodell von Nonaka und Takeuchi (1995) klassifiziert Wissen in explizites Wissen, das objektiv, kodifiziert, transferierbar und formaler Natur ist, und implizites Erfahrungswissen, das nur schwer oder gar nicht vermittelbar ist und nur sehr unzureichend kodifiziert vorliegt. Dieses implizite Wissen („tacit knowledge“) basiert auf Erlebnissen, Kultur, Emotionen und Werte und zeigt sich in methodischem und sozialen Kompetenzen mehr als in Qualifikationen, also auch in Handlungsroutinen und Vorgehensweisen, aber auch in überzeugungen, Glaubenssätzen und kulturellen festgeschriebenen Schemata. Die Explizierung eines impliziten Kontexts ist eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung neuen Wissens. „Zentral für den Ansatz ist die Erkenntnis, dass neues Wissen nicht einfach aus der Verarbeitung objektiver Informationen entsteht. Ebenso hängt dieser Vorgang von den stillschweigenden und of höchst subjektiven Einsichten, Eingebungen und Mutmaßungen des einzelnen ab, dieses zu prüfen und vom ganzen Unternehmen zu nutzen. Als Hebel dient dabei persönliches Engagement und die Bereitschaft aller, sich mit dem Unternehmen und seinen Auftrag zu identifizieren.“ (North 1998, S. 165) Die prozessuale Verknüpfung von vier verschiedene Formen der Wissensumwandlung auf der individuellen Ebene sind dabei charakteristisch für den Ansatz.
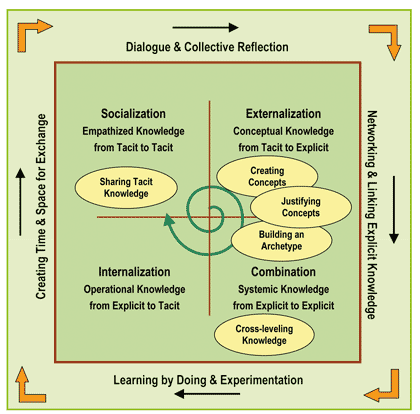
Abb: Wissenspirale und Phasen der Wissenserzeugung nach Nonaka und Takeuchi
Als Sozialisation (Socialization = tacit-to-tacit) wird der Erfahrungsaustausch bei horizontaler Kommunikation aber auch bei vertikaler Kommunikation bezeichnet. Im Austausch von Erfahrung entsteht im Gespräch, bei einer Konferenz oder durch Nachahmung Wissen, ohne dass dies explizit formuliert wird. Die Sozialisation führt zu sympathized knowledge wie gemeinsame mentale Modelle von Lern- und Arbeitssituationen oder das Erlernen notwendiger technischer Fähigkeiten, Handgriffe in der Industriearbeit oder Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Die Transformation von unbewusstem zu bewusstem Wissen wird nach dem Spiralmodell als Externalisierung (Externalization = tacit-to-explicit) bezeichnet. Unter Einbeziehung von Bildern, Metaphern oder Modellen wird bei der Externalisierung implizites Wissen so ausgedrückt, dass es von Anderen auch nachvollzogen werden kann. Das Resultat der Externalisierung wird als conceptual knowledge bezeichnet. Bei der Kombination (Combination = explicit-to-explicit) wird bestehendes explizites Wissen durch die Verbindung mit anderen Wissensinhalten zu neuem expliziten Wissen zusammengesetzt. Verschieden Inhalte können dabei medial transformiert, von analog zu digital und dabei durch Ergänzung um andere Kontexte, erweitert werden. Eine Kombination führt zu systemic knowledge, da hier Wissen in abrufbarer Form der Organisation zur Verfügung steht. Dabei wird nicht die Wissensbasis eines Unternehmens, also die Grundlage erweitert, sondern nur die Anwendungsbreite wie z.B. die Möglichkeit Prozesse auf andere Problemstellungen zu übertragen (Nonaka 1998, S. 29). Den umgekehrten Vorgang vom bewussten zum unbewussten Wissen nennen die Autoren Internalisierung (Nonaka und Takeuchi 1995, S. 62 ff.). Hier (Internalization = explicit-to-tacit) wird explizites Wissen in implizites Wissen transformiert, was bedeutet, dass Erfahrungen und Wissen, die durch die vorhergehende Sozialisation, Externalisierung oder Kombination gesammelt wurden, in individuelle mentale Modelle integriert werden. Die Internalisierung erzeugt operational knowledge (Müller 2008, S. 21).
Neben der Wissensumwandlung definieren Nonaka und Takeuchi fünf Phasen, in denen die Wissensspirale verläuft. In der ersten Phase wird implizites Wissen ausgetauscht. In der zweiten Phase werden Konzepte geschaffen. In der dritten diese Konzepte anderen vermittelt. In der vierten wird ein Prototyp entwickelt und in der fünften Phase das Wissen übertragen.
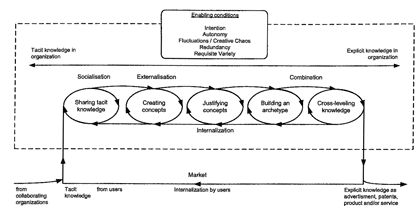
Abb: Phasenmodell der Wissensspirale (Nonaka und Takeuchi, S. 84)
Der Erfolg der Wissensspirale ist gemäß den Autoren an Bedingen geknüpft. Die Ziele der Wissensumwandlung sind identisch mit den Unternehmenszielen. Die Akteure sind relativ autonom in ihrer Entscheidung und können selbstorganisiert handeln. Durch organisationalen Austausch wird die abteilungsübergreifende Interaktion gefürdert. Müller (2008, S. 22) weist darauf hin, dass die Autoren Organisationen als offene Systeme betrachten, in denen externe Fluktuation die Entwicklung von neuen Wissen begünstigt und ein Mehrwert dadurch entstehen kann, dass Prozesse durch die Mitarbeiter reflektiert und analysiert werden können. Als vierte Bedingung gilt Nonaka und Takeuchi (1995, S. 80) die Informationsredundanz, da dadurch eine Verständnis geschaffen wird, dass Zuhören wichtig ist und so jedes Element des Systems , die gleiche Bedeutung und das gleiche Potenzial besitzt, die Führung zu übernehmen. Als fünfte Bedingung kann die erforderliche Varietät gelten, wobei die Organisation so unterschiedlich besetzt sein soll, wie es die Anforderungen der Varietät und Komplexität der Umwelt erfordern.
Kritik
In ihren Diskussionsbeitrag haben Schreyögg und Geiger (2003) wesentliche Problemfelder zum Ansatz des SECI-Modells genauestens beschrieben. Die grundsätzliche Einwendung, ob implizites, individuelles Wissen überhaupt durch eine Organisation inkorporiert werden kann, wird ausführlich im Beitrag zu den unterschiedlichen Wissensarten erörtert. Schreyögg und Geiger nehmen hier direkt Bezug auf die Begriffsabgrenzungen von Polanyi (1966, S. 20), nach denen implizites Wissen eben nicht verbalisierbar und nicht formalisierbar ist, ja der Versuch der Explizierung sogar die Gefahr beinhaltet das Wissen komplett zu zerstören. Polanyi nennt hier das Beispiel eines Klaviervirtuosen, bei dem der Versuch die einzelne Handgriffe zu beobachten und zu erklären, unweigerlich zum Spielstillstand führen würde.
Kritisch betrachten Schreyögg und Geiger (2003, S. 17ff) die Verallgemeinerung der Wissensspirale als das Standardmodell eines organisationalen Wissensbildungsprozesses. Der unterstellt Phasenverlauf und die Konversion erscheinen fragwürdig. Sie weisen darauf hin, dass Unternehmen auf unterschiedliche Weisen lernen. Der vorgegebene zyklische Ablauf der Wissensspirale ist eben nicht zwingend, implizites Wissen kann implizit bleiben oder explizit. Ebenso bezweifeln die Autoren, dass explizites Wissen grundsätzlich zu internalisieren ist, oder dass jeder Wissenserzeugungsprozess mit dem Individuum beginnen muss, denn häufig schließt sich organisationales Wissen unmittelbar an anderes organisationales Wissen an.
Bedeutsam für ein Wissensmanagement in der Veranstaltungsbranche ist der Ansatz von Nonaka und Takeuchi, da in der Wissensspirale alle Wissenserzeugung vom Individuum ausgeht und der Internalisierung die Explizierung gegenübergestellt werden kann. Ein Learning by doing ist in vielen Situationen der Veranstaltungsbranche die Regel, die Weitergabe von expliziten Wissen in Form von Direktiven, Arbeitsanweisung und Manuals bleibt dagegen die Ausnahme. Die Berücksichtigung und Wertschätzung des nicht kodifizierten individuellen Wissen ist daher von großer Bedeutung, doch wie gesamthaft der vorgegebene Zyklus in einer Wissensspirale kritisch betrachtet werden muss, fällt in der Veranstaltungsbranche schon die klare Trennung von Individuum und Organisation schwer. Dadurch wird aber auch der vierschrittige Prozess der Wissenserzeugung fraglich, denn während die Erfahrungsweitergabe als Sozialisationsprozess noch nachweisbar ist und auch die Kombination als Zusammenfügen von expliziten Inhalten unterschiedlicher Art oder Herkunft beschreibbar ist, sind die Konversionsprozesse von impliziten zum expliziten Wissen und umgekehrt schwer zu veranschaulichen. Die von Nonaka und Takeuchi hier ergänzten Phasen helfen nur wenig, da die Entwicklung eines Prototypen und darauf folgende Wissensübertragung in der Praxis kaum Anwendung findet. Gerade diese Konversion vom individuellen zum organisationalen Wissen und der damit verbundene Lernprozess, sind jedoch die Transformationsprozesse, die für ein Management von Wissen von größter Bedeutung sind. Hier bleibt das Modell zu starke traditionellen Organisationsstrukturen verhaftet und lässt sich auf die dynamischen Formen der Projektarbeit von selbstorganisiert arbeitenden Individuen nur als Annäherung an einen Prozess übertragen, der in der Nahsicht wesentlich komplexer verläuft als ein spiralformiger Wissenstransfer.
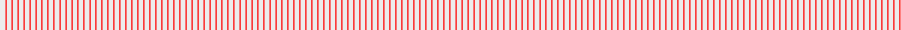
Literatur | Links
- Nonaka, Ikujiro / Takeuchi, Hirotaka 1995: The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press.
- North, Klaus 1998: Wissensorientierte Unternehmensführung. Wiesbaden: Gabler-Verlag
- Nonaka, Ikujiro 1998: The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review on Knowledge Management, Boston: Harvard Business School Press.
- Müller, Claudia 2008: Graphentheoretische Analyse der Evolution von Wiki-basierten Netzwerken für selbstorganisiertes Wissensmanagement. Berlin: Gito-Verlag
- Schreyögg, Georg /Geiger, Daniel 2003: Kann die Wissensspirale Grundlage des Wissensmanagements sein?, in: Diskussionsbeiträge des Instituts für Management, Bresser/ Krell/ Schreyögg (Hrsg.), No. 20/03.
- Polanyi, Michael 1966: The tacit dimension. London